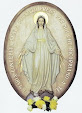Klicken Sie hier, um die Glocken von Oberdorf zu hören!
Unsere fortlaufenden Beiträge zur katholischen Schweiz | Nos contributions continuées pour la Suisse catholique | I nostri contributi continuati per la Svizzera cattolica



 Sankt Verena kam von Theben in Oberägypten, über Palästina, nach Mailand. Von hier über den Großen St. Bernhard nach St. Maurice, wo die thebäische Legion, ihres christlichen Glaubens wegen, dezimiert wurde. Verena half die Märtyrer bestatten. Weg von der Stätte des Grauens, zog Verena nach Solothurn (Verenaschlucht). Hier wird sie durch Hiertakus, den Statthalter, eingekerkert. Sie wird freigelassen, nachdem sie dem Statthalter durch ihr Gebet die Gesundheit erfleht hat. Der Aare entlang zieht sie nach Koblenz (321) und wohnt hier auf der Rheininsel. 323 zieht St. Verena nach Zurzach, wo bereits eine Christengemeinde besteht. Im römischen Siechenhaus pflegt St. Verena die "Siechen und Bresthaften". Die Symbole Krug und Kamm versinnbilden ihr Wirken. 344 starb St. Verena in Zurzach. Ihr Grab wurde schon im 8. Jh. dort verehrt, wo es heute noch steht. Benediktinermönche, bis zirka 1294, betreuten die Pilger. Nach dem großen Brande von 1294, dem das Kloster zum Opfer fiel, stiftete Königin Agnes von Königsfelden ein Chorherrenstift, welches 1876 vom Staate Aargau aufgehoben wurde. Die heutige, dreischiffige St. Verenabasilika wurde 984-988 erbaut. Gruft, Chor und Turm wurden 1346 in gotischem Stil erneuert. 1733 wurde der herrliche Bau durch den Meister Bagnato barockisiert. 1900 wurden die Stukkaturen aus dem gotischen Teile entfernt und die klassischen Formen wieder freigelegt.
Sankt Verena kam von Theben in Oberägypten, über Palästina, nach Mailand. Von hier über den Großen St. Bernhard nach St. Maurice, wo die thebäische Legion, ihres christlichen Glaubens wegen, dezimiert wurde. Verena half die Märtyrer bestatten. Weg von der Stätte des Grauens, zog Verena nach Solothurn (Verenaschlucht). Hier wird sie durch Hiertakus, den Statthalter, eingekerkert. Sie wird freigelassen, nachdem sie dem Statthalter durch ihr Gebet die Gesundheit erfleht hat. Der Aare entlang zieht sie nach Koblenz (321) und wohnt hier auf der Rheininsel. 323 zieht St. Verena nach Zurzach, wo bereits eine Christengemeinde besteht. Im römischen Siechenhaus pflegt St. Verena die "Siechen und Bresthaften". Die Symbole Krug und Kamm versinnbilden ihr Wirken. 344 starb St. Verena in Zurzach. Ihr Grab wurde schon im 8. Jh. dort verehrt, wo es heute noch steht. Benediktinermönche, bis zirka 1294, betreuten die Pilger. Nach dem großen Brande von 1294, dem das Kloster zum Opfer fiel, stiftete Königin Agnes von Königsfelden ein Chorherrenstift, welches 1876 vom Staate Aargau aufgehoben wurde. Die heutige, dreischiffige St. Verenabasilika wurde 984-988 erbaut. Gruft, Chor und Turm wurden 1346 in gotischem Stil erneuert. 1733 wurde der herrliche Bau durch den Meister Bagnato barockisiert. 1900 wurden die Stukkaturen aus dem gotischen Teile entfernt und die klassischen Formen wieder freigelegt.